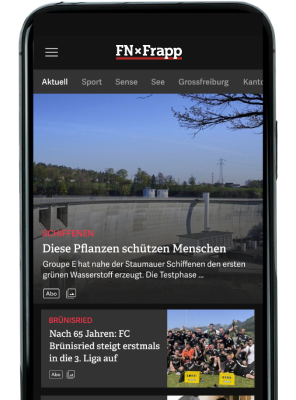Bundesrat bricht Verhandlungen ab
Die siebenjährigen Verhandlungen zu einem Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Der Bundesrat brach die Verhandlungen ab. Er habe am Mittwoch die EU-Kommission über diesen Entscheid informiert.
"Die Verhandlungen über den Entwurf des InstA sind somit beendet", teilte der Bundesrat im Anschluss mit. Laut der Regierung ist es aber im gemeinsamen Interesse der Schweiz und der EU, "die bewährte bilaterale Zusammenarbeit zu sichern und die bestehenden Abkommen konsequent weiterzuführen".
Das Justizdepartement von Karin Keller-Sutter wurde beauftragt, zu prüfen, wie das bilaterale Verhältnis "mit möglichen autonomen Anpassungen im nationalen Recht stabilisiert werden könnte", wie es weiter hiess.
Die einseitige Anpassung des Schweizer Rechts an die EU-Bestimmungen wird auch "Stabilex" genannt. Die Idee hinter dieser Strategie ist, mit einer einseitigen Rechtsübernahme in politisch unumstrittenen Bereichen der EU entgegenzukommen.
Ausserdem will sich der Bundesrat beim Parlament dafür einsetzen, die versprochene Kohäsionsmilliarde freizugeben. Vorgesehen sind 1,3 Milliarden Franken. Definitiv entscheiden über den Kohäsionsbeitrag kann nur das Parlament.
Unterhändlerin Leu in Brüssel
Die Schweiz bemühte sich am Dienstagabend um ein Telefongespräch zwischen Bundespräsident Guy Parmelin mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr.
Das Gespräch kam dem Vernehmen nach jedoch nicht zustande, weil die Schweiz keine näheren Angaben zum Gesprächsinhalt machen wollte. Daher reiste Staatssekretärin Livia Leu am Mittwoch nach Brüssel.
Verhandlungen seit 2014
Die Schweiz und die EU verhandelten seit rund sieben Jahren über ein institutionelles Rahmenabkommen zur Regelung der künftigen Beziehungen. Ende September 2018 teilte der Bundesrat mit, die Verhandlungen seien in diversen Punkten weit fortgeschritten, es blieben aber einige schwierigen Themen. Dazu gehörten insbesondere die EU-Unionsbürgerrichtlinie, die flankierenden Massnahmen und eine geplante Änderung des EU-Sozialversicherungsrechts. Im Dezember 2018 veröffentlichte der Bundesrat den Verhandlungstext und führte eine Konsultation durch.
Im Juni 2019 teilte der Bundesrat mit, dass Abkommen vorläufig nicht zu unterzeichnen. Er beurteilt das Verhandlungsergebnis zwar insgesamt positiv, verlangte aber "Klärungen".
Ende April reiste Bundespräsident Parmelin nach Brüssel, um EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu treffen. "So können wir das Abkommen nicht unterzeichnen", sagte er nach dem Treffen.
Um was es beim institutionellen Rahmenabkommen geht
Mit einem Rahmenabkommen sollen die Marktzugangsabkommen zwischen der Schweiz und der EU einen institutionellen Rahmen erhalten. Die EU will damit einheitliche Spielregeln für ihren Binnenmarkt sicherstellen.
Der Entwurf des Rahmenvertrags sieht vor, dass die Schweiz künftig bei der Personenfreizügigkeit, dem Luft- und Landverkehr, den Landwirtschaftsprodukten, bei den technische Handelshemmnissen sowie bei neuen Marktzugangsabkommen EU-Recht dynamisch übernimmt. Damit wären Referendumsabstimmungen weiter möglich. Ausserdem erhält die Schweiz beim EU-Gesetzgebungsverfahren ein Mitspracherecht.
Würde die Schweiz die Übernahme von EU-Recht jedoch ablehnen, kann ein Schiedsverfahren eingeleitet werden, das am Ende zu Ausgleichsmassnahmen seitens der EU führen kann. Überwacht wird das Ganze in erster Linie vom "Gemischten Ausschuss" - einem technischen Gremium, das bereits heute existiert.
Umstrittene Streitbeilegung
Im Vertrag vorgesehen ist auch eine einheitliche Rechtsauslegung, aber nur für jene Teile in den Abkommen, die sich auf EU-Recht beziehen. Kommt es bei der Interpretation zum Streit, kann ein Streitbeilegungsverfahren eröffnen werden.
Dieses Verfahren ist eine wichtige Neuerung und in der Schweiz stark umstritten. Gelingt eine Einigung im "Gemischten Ausschuss" nicht, kommt neu ein Schiedsgericht ins Spiel, das bestimmen muss, ob es sich beim Streitpunkt um EU-Recht handelt oder nicht. Bei Letzterem urteilt das Schiedsgericht selbst.
Handelt es sich um EU-Recht, entscheidet der EU-Gerichtshof (EuGH), wie das EU-Recht ausgelegt werden muss. Das Schiedsgericht urteilt dann unter Berücksichtigung der Vorgaben des EuGH.
Anerkennt Bern das Urteil nicht, darf die EU Ausgleichsmassnahmen ergreifen. Sind diese für die Schweiz unverhältnismässig, kann sie eine Beurteilung durch das Schiedsgerichts verlangen.
Noch offene Punkte
In drei Punkten gibt es bis jetzt jedoch noch keine Einigung - dazu zählen die flankierenden Massnahmen (FlaM). Brüssel gesteht der Schweiz vom EU-Recht abweichende Regelungen zu, kritisiert aber gewisse Massnahmen als unverhältnismässig.
Daher will es die Anmeldepflicht für EU-Dienstleistungserbringer von acht auf vier Tage reduzieren. Zudem soll die Kautionspflicht für EU-Dienstleistungserbringer nur noch bei "Risikobranchen" gelten. Auch bei der Bekämpfung von Scheinselbständigkeit pocht die EU auf eine weniger diskriminierenden Regelung.
Weiter wird über staatliche Beihilfen (z.B. Subventionen) gestritten. Diese sind unter bestimmten Bedingungen in der EU verboten - mit vielen Ausnahmen. Die EU will im Rahmenvertrag gewisse Grundsätze bei den Staatsbeihilfen festschreiben. Die Kantone fürchten jedoch Kompetenzverluste.
Weiterer Streitpunkt ist die Unionsbürgerrichtlinie (UBRL), die nicht direkt Gegenstand des Rahmenabkommens ist. Sie dürfte aber früher oder später aufs Tapet kommen, da Brüssel diese als Teil der Personenfreizügigkeit sieht. In der EU regelt sie u.a. den Anspruch auf Sozialleistungen oder das Aufenthaltsrecht von EU-Ausländern. Bern fürchtet daher hohe soziale Kosten auf die Schweiz zukommen.