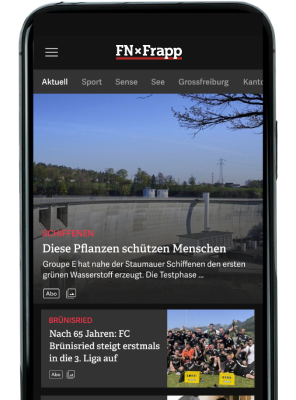De Röschtigraabe
Den Begriff Röstigraben haben viele Freiburger nicht gern. Eine Suche nach den Gründen. Ein Beitrag von Christian Schmutz.
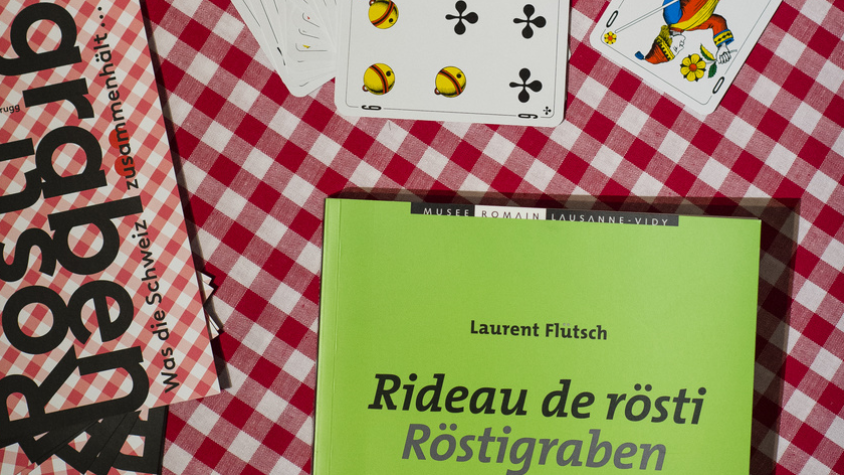
Ich denke, Röstigraben lehnen wir vor allem ab, weil er von aussen unsere Situation beschreiben will. Wer erlaubt sich da ein Urteil über Freiburg, ohne die Situation Freiburgs richtig zu kennen? Schǜsch giits no!
Wir wissen:
- Einzig am Anfang des Schiffenensees fallen Sprachgrenze und Saanegraben für kurze Zeit zusammen. Sonst ist outre Sarine für "Deutschschweiz" ein ziemlich notdürftiges welsches Konstrukt. Marly und La Roche liegen ja auf deutschsprachiger Seite der Saane, Gurmels und Murten auf welscher.
- Die Sensler, die ja direkt am angeblichen Röstigraben sitzen, sprechen ja ursprünglich von Brägù. Die Rösti hört man längst auch, ist aber von Bern importiert.
- Und: Die meisten Welschen haben früher von les roeschtis gesprochen als die Ostschweizer. Den Berner Begriff Röschti haben Romands schon im späten 19. Jahrhundert für die gebratenen Frühstückkartoffeln übernommen. Östlich von Luzern gab es diese Zmorge-Tradition mit Kartoffeln nicht. Es gab auch kein Einzelwort für die Umschreibung bbrateti Härdöpfel. Rösti kam dort erst Mitte des 20. Jahrhunderts auf.
Aus all diesen Gründen sollte man den Begriff Röstigraben verbannen und alle Bücher, die so etwas behaupten, verbrennen!
Aba, tùmms Gglafer.
Wir alle erleben Unterschiede zwischen Deutsch und Welsch. Oft leben wir im Alltag eher ein Neben- als ein Miteinander. Unser Interesse und Wissen an Literatur, Musik, Kabarett, Tanz, Theater und Film hängt sehr an der Sprache. Es gibt eine kulturelle und mentale Grenze.
Und dieses komplizierte Zusammenleben kann man mit einem einzigen Wort ausdrücken? Welch phantastische Marketing- und Kommunikationsleistung! Röstigraben ist wunderbar träf. Kein Wunder sind die Medien dankbar aufgesprungen. Ihr Platz für Titel und Schlagzeilen ist beschränkt.
Der Begriff kam übrigens erst in den 1980er-Jahren auf. Die Welschen sprachen da von barrière des roeschtis oder rideau de roeschti (also Röstigrenze oder Röstivorhang). Buchautor Christophe Büchi (natürlich heisst sein erfolgreichstes Buch «Röstigraben») schreibt: Erst da wurde das Verhältnis Deutsch-Welsch vermehrt problematisiert. Negativ ausgedrückt heisst dies: «Aus der Harmonie wurde zusehends eine Dissonanz.» Positiv ausgedrückt: «Die langjährige Gleichgültigkeit wich einem gespannten Interesse.» Dazu haben auch die Deutschfreiburger beigetragen, die endlich nicht mehr alles mit sich machen liessen.
Seit 1992 die EWR-Abstimmung genau der Sprachgrenze entlang die Ja- von den Neinsagern getrennt hat, gibts für den Begriff Röstigraben kein Halten mehr. Er boomt seither gewaltig und wird gar in allen Schweizer Landessprachen gebraucht.
In einem Aufsatz «Röstigraben – die Geschichte einer erfolgreichen Metapher» beschreibt Autor Büchi dieses Bild. Es verbinde ideal den uralten, häufig für Differenzen und Schwierigkeiten gebrauchten «Graben» (einen Graben aufreissen, noch nicht über den Graben sein) und das Emotionale aus der Kulinarik. Mit die Röschti, les reuchtis ist es erst noch verständlich für Welsche und etymologisch klar als Deutsch erkennbar. Perfekt!
Der langen Rede kurzer Sinn: Röstigraben ist zwar überspitzt und stimmt nicht genau, aber man kann ja einen Graben erkennen. Oder Büchi sagt: «Der Röstigraben ist zwar ein Schlagwort, ein Schlagwort aber, das ein reales Problem benennt.»Und wenn jemandem der Begriff nicht gefällt, soll er einen besseren finden. Oder er sucht und vermittelt so oft mit den Welschen Kontakt, dass Mentalitäts-, Kultur- und Sprachunterschiede sich immer mehr angleichen – und jeglicher Graben zugeschüttet ist.