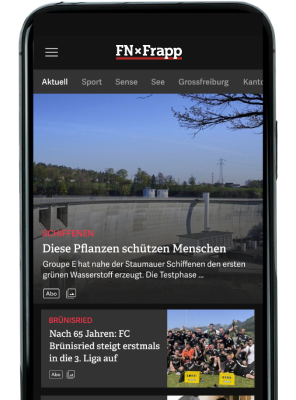Einige Schweizerdeutsche Wörter sterben aus
Bis zum Ende des Jahrhunderts wird das Schweizerdeutsch an Vielfalt verlieren. Wörter, die dem Standarddeutschen nahestehen, werden sich weitgehend durchsetzen.
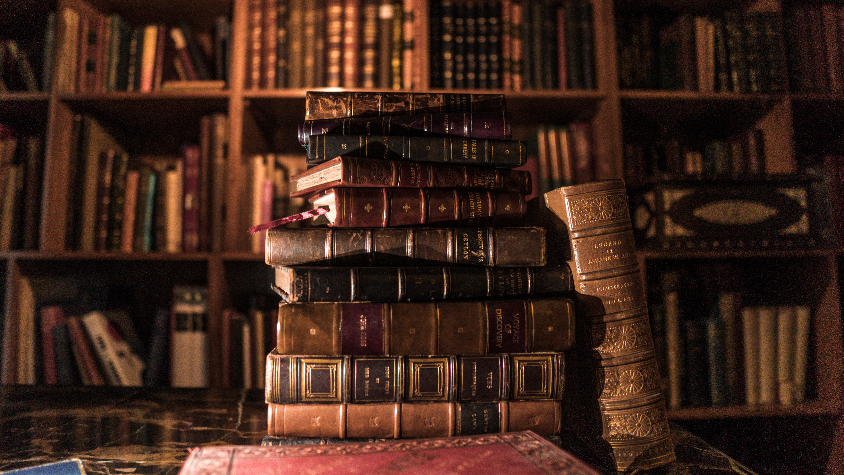
Der Schmetterling wird bis 2060 nur noch als "Schmätterling" bezeichnet werden, während die Varianten "Summervogel" und "Pfifolter" verschwunden sein werden. Generell wird das Schweizerdeutsch an Vielfalt verlieren und Wörter, die dem Standarddeutschen nahestehen, werden sich weitgehend durchsetzen, so eine Studie des Germanistikprofessors Adrian Leemann von der Universität Bern, die am Donnerstag im Tagesanzeiger thematisiert wurde.
Der Begriff "Summervogel", der 1940 von fast der Hälfte der Deutschschweizer für Schmetterlinge verwendet wurde, wird verschwinden, bestätigte Leemann gegenüber Keystone-ATS im Anschluss an den Artikel der Zürcher Tageszeitung.
Auch andere Dialektbegriffe drohen aus der Mode zu kommen. So wird beispielsweise das Wort "Kanapee" (Sofa), das früher von zwei Dritteln der Deutschschweizer verwendet wurde, bis zum Jahr 2100 voraussichtlich vollständig verschwinden. Es wird weitgehend von seinem deutschen Pendant "Sofa" verdrängt werden. Lediglich im Wallis und in Graubünden dürfte man weiterhin auf einem "Ggutschi" oder "Ggusch" sitzen.
Der Experte schätzt ausserdem, dass in 80 Jahren die "Anke" (Butter) nur noch in Bern auf das Brot gestrichen wird. Die anderen Kantone werden sich für den deutschen Begriff "Butter" entscheiden. Bis 2060 dürften die anderen regionalen Varianten, wie z. B. "Schmalz", weitgehend ausser Gebrauch sein.
Vereinheitlichung des Wortschatzes
Generell zeigt die Studie, dass die Anzahl der Wörter weiter abnehmen wird. Während es 1940 21 Möglichkeiten gab, Löwenzahn zu sagen, sind es heute nur noch neun. Der Germanistikprofessor schätzt, dass im Jahr 2100 die gesamte Deutschschweiz nur noch von "Löwenzahn" für Löwenzahn sprechen wird, während der Begriff "Söiblueme" verschwunden sein wird.
Grundsätzlich würden sich Begriffe durchsetzen, die ihren standarddeutschen Entsprechungen ähnelten oder in Zentren wie Bern und Zürich gebräuchlich seien, erklärte Leemann.
Die Prognosen basieren auf Erhebungen zu den Dialekten der Lost Generation (geboren zwischen 1880 und 1900), der Baby Boomer (1940-60) und der Millennials (1980-2000). Anhand einer statistischen Modellierung wurden auf der Grundlage dieser Daten Prognosen über die Zukunft der schweizerdeutschen Dialekte erstellt.