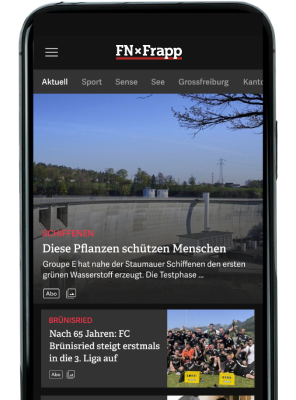Pragmatische oder erzwungene Zweisprachigkeit?
Dominique de Buman befürchtet mit dem Fusionsprojekt Nachteile für die französischsprachige Mehrheit. Ruth Lüthi widerspricht.
Am 26. September findet die Konsultativabstimmung zur Fusion Grossfreiburg statt. Mit Dominique de Buman und Ruth Lüthi haben bei RadioFr. zwei politische Schwergewichte Freiburgs über die Rolle der Zweisprachigkeit bei diesem Projekt diskutiert.
Dominique de Buman, ehemaliger Syndic von Freiburg und bis 2019 Mitte-Nationalrat, ist seit Kurzem Vorstandsmitglied der Communauté Romande du Pays de Fribourg. Der Verein wehrt sich gegen das Fusionsprojekt. Ruth Lüthi war bis 2006 Staatsrätin und ist Co-Präsidentin des Vereins Fusion 21, der sich für Grossfreiburg einsetzt.
Zweisprachigkeit im Alltag und im Gesetz
"Ich hatte immer Lust und Freude, Deutsch zu sprechen", stellt Dominique de Buman gleich zu Beginn der Diskussion klar. "Manchmal gibt es aber eine Verwechslung zwischen der persönlichen Zweisprachigkeit und der institutionellen." Für ihn ist die angestrebte "pragmatische Zweisprachigkeit", wie sie die Fusionsvereinbarung vorsieht, zu wenig klar definiert. Darin sieht er ein juristisches Problem.
Ruth Lühti kontert: "Es handelt sich um das, was wir in der Stadt Freiburg schon kennen." Davon würden nach der Fusion auch die deutschsprachigen Minderheiten in den anderen acht Gemeinden profitieren. Konkret sieht die Fusionsvereinbarung vor, dass die offizielle Sprache der Gemeinde Grossfreiburg französisch wäre, die deutschsprachige Minderheit sich aber in ihrer Muttersprache an die Verwaltung wenden dürfte.
Zweisprachigkeit zulasten der Mehrheit
De Buman macht sich jedoch Sorgen, dass unter dem Deckmantel der pragmatischen Zweisprachigkeit die Rechte der Minderheit so stark ausgeweitet werden, dass der französischsprachigen Mehrheit dadurch Nachteile entstehen. Als Beispiel nimmt er den Generalrat. Sollten die Debatten im Stadtparlament plötzlich auf Schweizerdeutsch geführt werden, könne die Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier dem Geschehen nicht mehr folgen.
Diese Sorge kann Lüthi nicht nachvollziehen. "Wir haben im Generalrat zu 90 Prozent Französisch gesprochen." Und wenn Französisch, dann Hochdeutsch. Schliesslich wolle man von der Mehrheit verstanden werden. Weiter betont Lüthi, dass kein bestehendes Gesetz durch die Fusion verändert wird. Ansonsten brauche es einen normalen demokratischen Prozess.
Zweisprachigkeit als ungelöste Frage
Einen solchen möchte de Buman am liebsten auf einer höheren Ebene. "Es gibt auch französischsprachige Minderheiten in Gemeinden wie Tafers oder Düdingen." In Tentlingen seien sogar 28 Prozent der Bevölkerung französischsprachig. In Grossfreiburg hingegen würden die deutschsprachigen 11 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner ausmachen. "Es wäre gut, wenn wir eine Freiburger Lösung finden, die über das städtische Gebiet hinaus beraten wird."
So lange möchte Ruth Lüthi aber nicht warten. Mit der vorliegenden Lösung sollen die Menschen in Kontakt mit der anderen Kantonssprache kommen und motiviert werden, sie zu lernen. So wird nämlich die individuelle Zweisprachigkeit gefördert, zeigt sich Lüthi überzeugt.